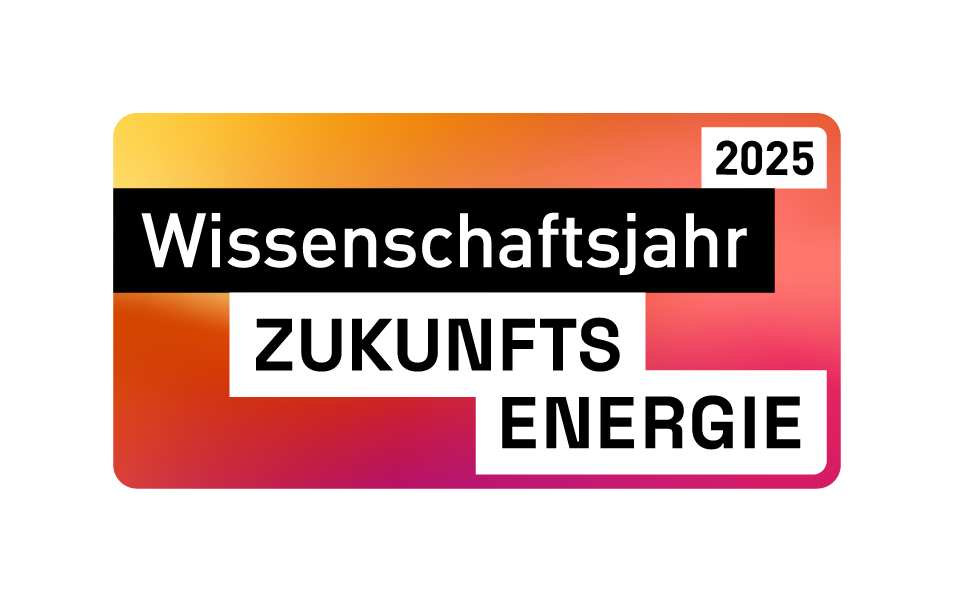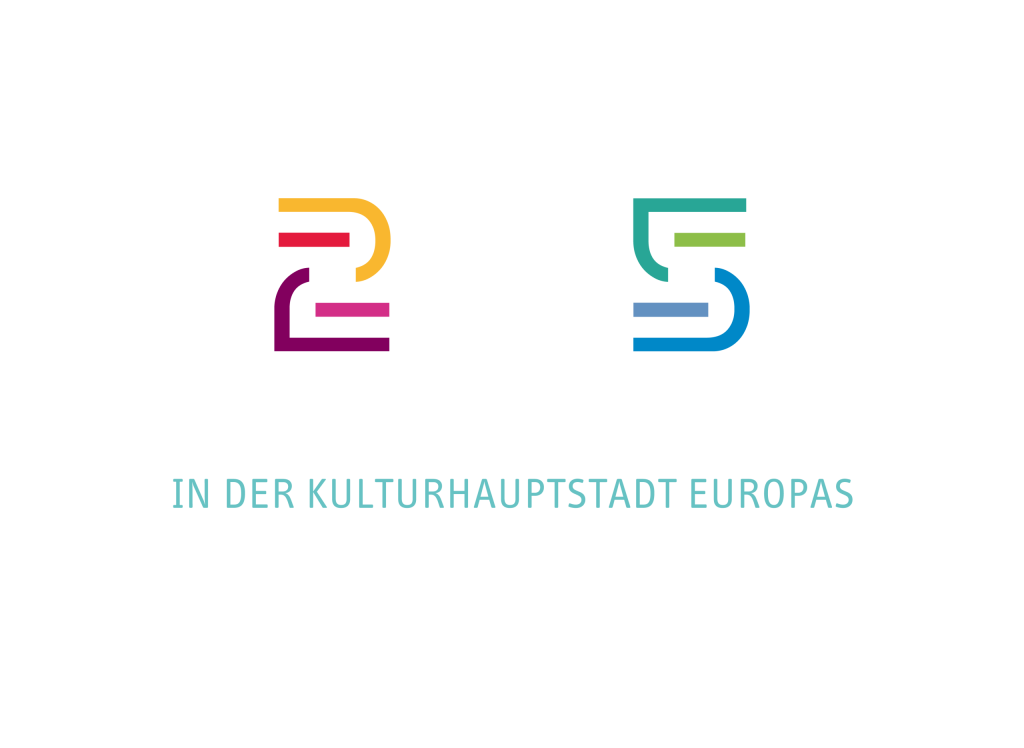Veranstaltung 2: Solarenergie
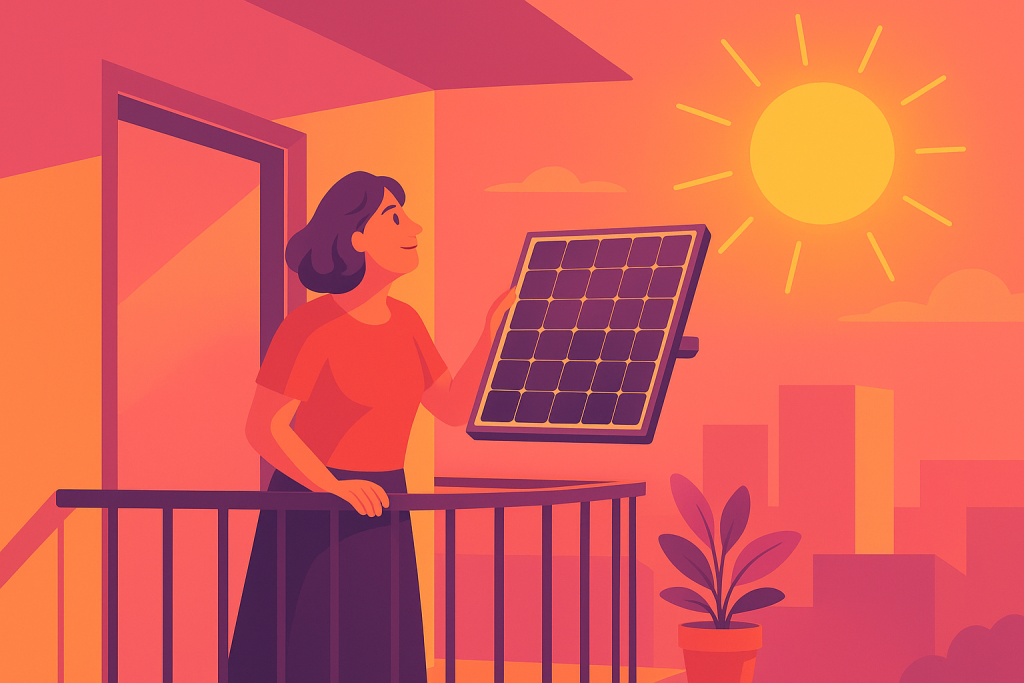
Die Sonne ist für alle da, und ebenso betrifft die Energiewende die gesamte Gesellschaft. Daraus folgt, dass auch alle einen Beitrag leisten sollen, die es können – nicht nur Industrie und Politik, sondern auch Privatpersonen, etwa durch Solaranlagen auf Hausdächern oder durch kleine Balkonkraftwerke. Dank staatlicher Fördermittel und sinkender Anschaffungskosten ist dies inzwischen nicht mehr allein Wohlhabenden vorbehalten, sondern zunehmend auch für Haushalte mit geringerem Einkommen möglich.
Einladung zur Online-Diskussion: „Die Sonne ist für alle da“
10. September 2025
16:00 – 18:00 Uhr
Solarenergie steht allen zur Verfügung – doch ist ihre Nutzung wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Während Industrie und Politik längst gefordert sind, können auch Privatpersonen durch Solaranlagen, Balkonkraftwerke und Förderprogramme einen Beitrag leisten. Oder gibt es gute Gründe, warum das nicht jede*r tun sollte?
Diese Fragen stehen im Zentrum der zweiten Online-Debatte von Offen für Argumente im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2025 „Zukunftsenergie“. Mitdiskutieren werden:
- Stefanie Siegert & Lorenz Bücklein, Verbraucherzentrale Sachsen
- Dr. Matthias Müller, TU Bergakademie Freiberg
Alle Interessierten – von Studierenden bis Fachleuten, von Bürger*innen bis Entscheidungsträger*innen – sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.
Unsere These
Die Sonne ist für alle da – sie macht keinen Unterschied zwischen arm und reich. Deshalb sollte auch die Nutzung der Solarenergie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Politik und Industrie tragen dabei die Hauptverantwortung, doch auch Bürger*innen können mit Solardächern oder Balkonkraftwerken unmittelbar zur Energiewende beitragen. Jede installierte Anlage ist ein Schritt hin zu mehr Klimaschutz, regionaler Wertschöpfung und Unabhängigkeit von fossilen Energien.
In der Realität ist der Zugang allerdings deutlich komplizierter, als es die politischen Schlagworte vermuten lassen. Zwar sind die Preise für Solarmodule und Speicher in den vergangenen Jahren gesunken, und es gibt Förderprogramme auf Landes- und Bundesebene. Doch viele Menschen wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt, welche Förderungen sich kombinieren lassen oder wie man Anträge korrekt stellt. Oft schrecken komplizierte Verfahren, kurze Fristen oder der bürokratische Aufwand ab. Hinzu kommt, dass Fördertöpfe schnell erschöpft sind und Eigenkapital häufig eine Voraussetzung bleibt. Für Haushalte mit wenig finanziellen Spielräumen ist der Zugang damit trotz Förderung stark eingeschränkt.
Damit stellt sich eine zentrale Frage: Zahlen am Ende alle Bürger*innen über ihre Steuern für Solar-Förderprogramme, profitieren aber vor allem jene, die über Eigentum und Kapital verfügen? Denn Eigentümerinnen mit Dachfläche können Zuschüsse nutzen und langfristig Stromkosten sparen, während Mieterinnen oder ärmere Haushalte kaum teilhaben. Balkonkraftwerke wären eine Chance für breite Beteiligung, stoßen aber noch immer auf praktische Hürden wie Netzanschlussfragen oder unklare Zuständigkeiten.
Hier kommt die Rolle von Beratungsstellen wie der Verbraucherzentrale Sachsen ins Spiel. Sie bietet Orientierung, informiert über Fördermöglichkeiten, unterstützt bei Anträgen und hilft Bürger*innen, die individuell passenden Lösungen zu finden. Dennoch erreicht diese Beratung bislang nicht alle Zielgruppen – gerade dort, wo Informationsdefizite am größten sind.
Auch die Forschung spielt eine wichtige Rolle. Einrichtungen wie die TU Bergakademie Freiberg entwickeln Technologien weiter, analysieren ökonomische und soziale Aspekte der Energiewende und liefern wissenschaftliche Grundlagen für eine gerechtere und effizientere Nutzung der Solarenergie. Forschung kann dabei helfen, kostengünstigere Systeme zu entwickeln, und Impulse geben, wie Förderstrukturen sozial ausgewogener gestaltet werden können.
Die Kernfrage bleibt jedoch: Wie schaffen wir es, die Solarenergie tatsächlich für alle zugänglich zu machen? Wenn die Sonne allen gehört und die Energiewende die gesamte Gesellschaft betrifft, sollten auch alle Menschen die Chance haben, sich daran zu beteiligen – nicht nur Politik und Industrie, sondern auch Bürger*innen. Mit den aktuellen Förderstrukturen ist das noch nicht durchgängig gegeben. Deshalb muss diskutiert werden, ob private Solarenergie heute wirklich allen offensteht oder ob sie in der Praxis weiterhin vor allem ein Privileg der Wohlhabenden bleibt.
Unsere Proponent*innen

Stefanie Siegert
Verbraucherzentrale Sachsen
Stefanie Siegert, geboren 1987, ist Volljuristin und hat beide Staatsexamen in Leipzig absolviert. Seit 2015 ist sie bei der Verbraucherzentrale Sachsen tätig, wo sie sich mit großem Engagement für den Verbraucherschutz einsetzt. Derzeit leitet sie den Bereich Energie, Digitales und Mobilität.
Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im politischen Lobbying zu verbraucherrelevanten Themen sowie in der fachlichen Begleitung von Projekten an der Schnittstelle von Energie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Stefanie Siegert bringt langjährige Erfahrung in der Interessenvertretung von Verbraucher*innen mit.
Sie engagiert sich insbesondere für mehr Transparenz auf dem Anbietermarkt, eine stärkere Teilhabe von Verbraucher*innen sowie eine wirkungsvolle Interessenvertretung im Sinne eines fairen und zukunftsfähigen Verbraucherschutzes.

Dr. Matthias Müller
TU Bergakademie Freiberg
Dr. Matthias Müller erwarb 2009 sein Diplom in Physik an der Universität Leipzig und promovierte 2014 an der Leibniz Universität Hannover. Ab 2007 arbeitete er für Q-Cells SE, GP Inspect GmbH, die Hochschule Magdeburg-Stendal und SolarWorld Innovations GmbH, bevor er 2017 als Leiter der Photovoltaik-Gruppe ans Institut für Angewandte Physik an die TU Bergakademie Freiberg kam.
Sein Forschungsgebiet verbindet numerische Bauelementesimulation mit Berechnungen zur Zuverlässigkeit und Energieausbeute von Solarzellen mit dem Ziel der Habilitation. Seit 2010 hält er regelmäßig Vorlesungen zu Themen wie „PV-Systeme“, „Energiewandlung und Speicherung“ sowie „Physik und Charakterisierung von Solarzellen“.